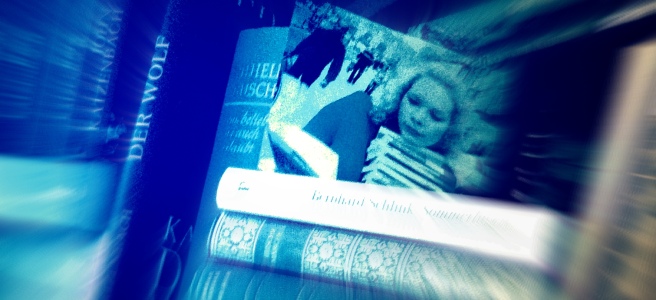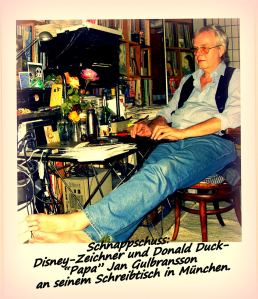Der Herbst ist da. Die Blätter taumeln zu Boden, um leere Äste zu hinterlassen. Der Wind pfeift schaurig. Und der Regen prasselt gegen die Fensterscheibe. Zeit für Gänsehaut. Keine Jahreszeit ist besser geeignet, um sich mit einem Krimi auf dem Sofa gemütlich zu machen. Oder doch lieber was zum Schmunzeln gegen den ersten Herbst-Blues? Bitte sehr, hier ist lecker Lesefutter.
Das ist neu:

Kinder sind wunderbar. Sie reden wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Etikette? Kennen sie nicht. Wir Erwachsenen wissen, die Wahrheit ist grausam. Also haben wir gelernt, die Contenance zu wahren und kommunizieren mit höflich ausgewähltem Vokabular plus einem „Zwischen den Zeilen“-Dialekt mit einer Prise Sarkasmus.
Autor Peter Grünlich ist da Kind im Manne. „Es sind die Sätze, die nicht ausgesprochen werden, die so viel über uns sagen“, philosophiert er und präsentiert seine Nicht-sagen-Lieblingssatz-Sammlung in „Die Jeans ist nicht zu klein, dein Hintern ist einfach zu dick“ (8,99 Euro, Knaur Verlag).
Was würde uns über US-Präsident Barack Obama nie über die Lippen kommen? „Rethorisch erinnert er an den früheren Edmund Stoiber.“ Und: „Er hat einfach nicht das Charisma von Angela Merkel.“ Moderatorin Barbara Schöneberger – das ist doch „die mit den Schlitzaugen. Ich glaube, die ist magersüchtig.“ Homann-o-mann … „Unser Kind ist nicht faul, es ist dumm.“ – da hat Papa wohl wieder zu tief ins Glas geschaut?
„2432 Dinge, die garantiert keiner sagen würde“ sagen nichts und sind doch nicht nichtssagend. Seltene Satzschätze, fein aneinander gereiht, die schmunzeln lassen. Ab 1. November im Handel. Unbedingt vorbestellen!
Das geht immer:
Ich bin gierig. Ob einen 500-Seiten-Schinken oder ein zartes Reclam-Büchlein, ich verschlinge alles. Mein Bücherregal ächzt unter der gewaltigen Wortsammlung und hält ihr Stand – ein treuer Freund. Ein Autor dominiert: John Katzenbach. Dunkel. Scharfsinnig. Gänsehaut-Garant. Mein Liebling: „Der Wolf“ (19,99 Euro, Knaur Verlag). 2012 erschienen, immer noch lesenswert. Auch beim 2. Mal.
„Niemand hat je getan, was ich vorhabe. Drei völlig unterschiedliche Opfer. An drei völlig verschiedenen Orten. Drei verschiedene Todesarten. Alle am selben Tag. Binnen weniger Stunden. Vielleicht sogar Minuten. Ein Tod, der wie ein fallender Dominostein den nächsten mitreißt. Klick. Klick. Klick“, schreibt er.
Er ist ein Schriftsteller, den keiner mehr liest. Seine Bestseller-Bücher gibt’s in keiner Buchhandlung mehr. Was macht ein Autor, dessen Wörter keiner Beachtung schenkt? Er mordet. Seine Inspiration: das Grimmsche Märchen „Rotkäppchen“. Happy End: ausgeschlossen. Blutig soll es werden, wie die unzensierte Original-Fassung. Die Opfer des Bösen Wolfs: drei rothaarige Frauen, akribisch durchnummeriert in „Rote Eins“, „Rote Zwei“, Rote Drei“.
Schon seit längerer Zeit beschattet er die vereinsamte 51-jährige Internistin Dr. Karen Jayson, die „Rote Eins“. Sie ist sein erstes Opfer. „Rote Zwei“ wird Sarah Locksley, eine Lehrerin, die bei einem tragischen Verkehrsunfall ihren Mann und ihre kleine Tochter verloren hat. Und bei „Rote Drei“ ist seine Wahl auf die 17-jährige College-Studentin Jordan Ellis gefallen, die in der Schule zunehmend versagt, weil sie den endlosen Rosenkrieg ihrer Eltern nicht verkraftet. So unterschiedlich die drei Frauen auch sind, jede von ihnen steckt tief in einer Lebenskrise.
„Du wurdest auserwählt zu sterben“, kündigt der Böse Wolf in einem Brief an und bringt „seine Roten“ vollends aus dem Gleichgewicht. Sie wissen weder, ob ihr Mörder zuschlagen wird, noch wie. Als kurz darauf alle drei einen Link zu einem YouTube-Video erhalten, aufgenommen in Situationen, in denen sie sich unbeobachtet glaubten, ist den Frauen endgültig klar, dass ihr Jäger ihnen ganz nah ist. Das kann kein übler Scherz mehr sein. Der schwere Atem des Wolfs scheint ihnen direkt im Nacken. Wann schlägt er zu? Wann kommt der Tod? Panik. Verzweiflung. Und der Leser? Die Augen fliegen über die Seiten und können es nicht erwarten, dass die Hand die nächste Seite umblättert. Atemlos wie die Opfer.
Was tun wir, wenn alles verloren scheint? Wir beruhigen uns. Wir suchen Hilfe. Wir verkriechen uns an einem sicheren Ort. Doch was, wenn der Mörder uns schon drei Schritte voraus ist? Wenn er genau das erwartet? Die drei Frauen taumeln voller Angst durch ihren Alltag. Als sie herausfindet, dass sie nicht alleine sind, dass es zwei weitere Opfer gibt und es ihnen gelingt, miteinander in Kontakt zu treten, sehen die drei eine Chance. Sie wollen ihm zuvorkommen, ihn töten. Hoffnung flammt auf. In geheimen Treffen schmieden sie Pläne. Doch der Wolf ist clever. Zermürbende Angst macht sich wieder breit – zu Recht. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt.
Maximale Spannung bis zur letzten Seite. Das Böse subtil herauszuarbeiten, präzise gezeichnete Charaktere und psychologisch ausgefeilte Schilderungen beklemmender Situationen sind John Katzenbachs Stärke. Das Ende überrascht. So ist er, der Katzenbach.
Mareike Köster